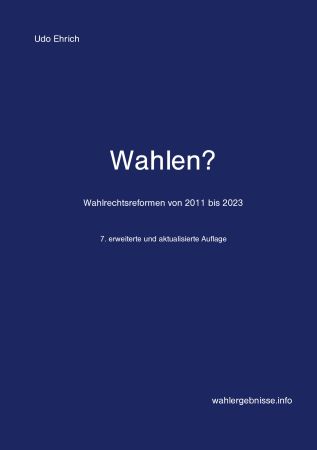Europäisches Parlament Wahlen Themen Sitzverteilung Bundespräsident Wahlleiter US-Präsidentschaftswahlen Österreich
wahlrechtsreform2023.de Weblog
Sonderseiten
Wahlwiederholung Berlin BSW-Ergebnisse
Wahlen Themen
Negatives Stimmgewicht und Grabenwahlsystem
Zu den großen Projekten der Politik gehört die nun anstehende Wahlrechtsreform , die nach dem Urteil zum sogenannten negativen Stimmgewicht notwendig geworden ist. Das Verfassungsgericht hat erklärt, daß das negative Stimmgewicht gegen die Verfassung verstößt und der Gesetzgeber nunmehr das Wahlrecht so zu ändern hat, daß dieser mathematische Effekt nicht mehr auftritt.
Um den Effekt des negativen Stimmgewichts zu verstehen, ist eine gewisse Vertrautheit mit dem deutschen Wahlsystem notwendig:
Bei der Bundestagswahl hat jede/r Wähler/in zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird der Wahlkreiskandidat nach Mehrheitswahlrecht gewählt. Mit der Zweitstimme, die in unserem Wahlrecht wichtiger ist, wird die Landesliste der Partei gewählt und damit die Zusammensetzung des Bundestages bestimmt. Bei der Auszählung der Stimmen für den Bundestag wird zwischen Ober- und Unterverteilung unterschieden: Zunächst wird über die Zweitstimmen die Stärke der Fraktionen im Bundestag bestimmt. Dann erfolgt die Besetzung der Sitze in dem Teil des Verfahrens, der Unterverteilung genannt wird, über die Landeslisten der Parteien. Dabei werden die Stimmen auf der Ebene der Bundesländer nach dem Zweitstimmenergebnis des jeweiligen Landes auf die Landeslisten der Parteien verteilt.
Im Rahmen der Auszählung der Stimmen können zwei Arten von Überhangmandaten entstehen, nämlich die internen und die externen Überhangmandate. Externe Überhangmandate fallen bei der Oberverteilung an, also in jenem ersten Schritt, in dem die Stärke der Fraktionen nach dem Bundeszweitstimmenergebnis bestimmt werden. In der Geschichte der Bundesrepublik sind diese externen Überhangmandate bislang nur einmal angefallen, und zwar bei der Bundestagswahl 2009 für die CDU.
Interne Überhangmandate sind solche, die bei der Verrechnung der Direktmandate im Rahmen der Unterverteilung entstehen. Stehen einer Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate zu, als dies nach dem Zweitstimmenergebnis der Fall ist, darf die Partei diese Mandate (= interne Überhangmandate) behalten. Bei der Bundestagswahl 2009 gewann die CDU genau so viele Direktmandate, wie ihr nach dem Zweitstimmenergebnis auf Bundesebene zugestanden hätten. Die CSU, die bekanntlich nur in Bayern antritt, gewann auf Bundesebene drei Direktmandate mehr, als ihr nach dem Bundeszweitstimmenergebnis zugestanden hätten. Wäre, wie es die Linkspartei als Lösung des Problems des negativen Stimmgewichts vorschlägt, auf die Unterverteilung verzichtet worden und die Stimmen auf die Listen der Parteien nur im Rahmen der Oberverteilung vorgenommen worden, hätte es nur drei statt 24 Überhangmandate gegeben.
Bei der Unterverteilung der Mandate in den Ländern auf die Landeslisten gewann die CDU dann 21 Mandate hinzu, eben durch den Umstand, daß die Partei auf Landesebene mehr Direktmandate gewonnen hatte, als ihr nach dem Landeszweitstimmenergebnis zustanden.
An dieser Stelle entsteht auch in willkürlicher, weil nicht vorab berechenbarer Weise, das Problem des negativen Stimmgewichts: Hat eine Partei in einem Bundesland Überhangmandate, dann spielt es für die Partei im Bundesland keine Rolle mehr, welchen Zweitstimmenanteil sie hat. Je mehr Zweitstimmen eine solche Partei hat, desto mehr Direktmandate werden durch die Zweitstimmen gedeckt. Nun kann es passieren, daß eine Partei mit Überhangmandaten in einem Bundesland davon profitieren kann, wenn sie weniger Zweitstimmen hat. In dem betreffenden Bundesland spielt es, wie gesagt, keine Rolle, ob bei zum Beispiel 15 Direktmandaten 12 oder nur 11 durch Zweitstimmen gedeckt sind. Wenn aber in einem solchen Fall die Zahl der Zweitstimmen sinkt, so daß weniger Mandate durch Zweitstimmen gedeckt sind, kann es passieren, daß eine Stimme in ein anderes Bundesland abwandert. Wenn die Partei, die in dem einen Bundesland die Überhangmandate hat, in dem anderen Bundesland, welches nun ein Mandat hinzugewinnt, bei der Verteilung der Mandate an der Reihe ist, gewinnt die Partei durch einen Verlust an Zweitstimmen ein Mandat hinzu. Wenn aber die Zahl der Zweitstimmen so steigt, daß in unserem Beispiel nicht mehr nur 11 sondern 12 Direktmandate der Partei durch Zweitstimmen gedeckt sind, wandert das Mandat nicht ins andere Bundesland und die Partei »verliert« ein Mandat. Tatsächlich kann man sich darüber streiten, ob die Partei das Mandat tatsächlich verliert, denn es stünde ihr ja eigentlich nach dem Zweitstimmenergebnis ohnehin nicht zu.
Dennoch ist es ein paradoxer Effekt, der bei der Sitzverteilung nicht auftreten darf. Die Wähler/innen haben zu Recht nach Auffassung des Verfassungsgericht ein Recht darauf, mit ihrer Stimmabgabe ihrer Partei nicht zu schaden, oder ihr nur durch Stimmenthaltung zu nutzen. Dies ist jedoch bewußt gar nicht möglich, weil der Effekt willkürlich auftritt.
Die Verteilung der Direktmandate nach Mehrheitswahl ist der Verhältniswahl grundsätzlich nachgeordnet: Bei der Unterverteilung werden zunächst die errungenen Direktmandate verteilt und die den Parteien danach noch zustehenden offenen Sitze über die Landeslisten der Parteien zugewiesen. Aus diesem Grund spielt es auch keine Rolle, daß Direktmandate teilweise ohne die absolute Mehrheit, also mit weniger als 50% der abgegebenen Stimmen, errungen werden: Abgesehen von den Überhangmandaten spielen die Direktmandate für die Sitzverteilung im Bundestag keine Rolle. Die Stärke der Fraktionen hängt von den Zweitstimmen und damit dem Verhältniswahlrecht ab.
Kommt es zu Überhangmandaten, verzerren diese das Zweitstimmenergebnis, weil sie bei der Verteilung der Mandate nicht ausgeglichen werden. Hat eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate errungen als ihr nach Zweitstimmen zustehen, behält die Partei die Mandate, auch wenn das Wahlergebnis dadurch leicht verzerrt wird. In der Geschichte der Bundesrepublik hat jedoch die Mehrheitsbildung noch nie von Überhangmandaten abgehangen. Die Verzerrung des Zweitstimmenergebnisses durch die Überhangmandate bleibt indes ein Problem, weil sie theoretisch dazu führen können, daß sich Mehrheiten entgegen dem im Zweitstimmenergebnis geäußerten Wähler/innenwillen verändern können.
Insofern bietet es sich an, bei der Beseitigung des negativen Stimmgewichts auch die Überhangmandate zu beseitigen, denn wenn es diese nicht mehr gibt, kommt es auch nicht mehr zum negativen Stimmgewicht. Dazu stehen mehrere Konzepte zur Debatte.
Naheliegend wäre es, die Überhangmandate der überhängenden Partei mit Listenmandaten anderer Bundesländer zu verrechnen. Warum Listenmandate anderer Bundesländer und nicht des betroffenen Landes? Weil in einem Land, in der eine Partei Überhangmandate erringt, die Landesliste nicht mehr zum Zuge kommt und es keine Mandate zur Verrechnung gebe. Ein anderer Vorschlag, der auch von dem durch Wirtschaftsunternehmen finanzierte »Konvent für Deutschland« vertreten wird, ist die Einführung des sogenannten »Grabenwahlsystems«.
Bei diesem Wahlrecht wird sozusagen ein Graben zwischen Erst- und Zweitstimme gezogen. Bislang ist es so, daß die Zweitstimme über die Sitzverteilung entscheidet und die Direktmandate, die eine Partei erringt, verrechnet werden - bislang mit Ausnahme der Überhangmandate. Beim Grabenwahlsystem würden die Direktkandidaten der 299 Wahlkreise nach wie vor nach Mehrheitswahl gewählt, ihre Mandate aber nicht mehr mit dem Zweitstimmenergebnis verrechnet. Mit der Zweitstimmen würden die Wähler/innen die anderen 299 Mandate nach Verhältniswahlrecht bestimmen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Auch die Absicht, die hinter dem Eintreten für ein solches Wahlrecht steht, ist leicht zu durchschauen, wenn man sich die Folgen anschaut.
Es würden somit zwei Kategorien von Abgeordneten im Parlament sitzen: 299 Abgeordnete, die direkt nach Mehrheitswahl in ihren Wahlkreisen gewählt werden und 299 Abgeordnete, die über Verhältniswahl bestimmt werden. Weil hier die Direktmandate nicht mehr mit den Listenmandaten verrechnet werden, kommt es auch nicht mehr zu Überhangmandaten. Im Bundestag würden nach jeder Wahl exakt 598 Abgeordnete sitzen.
Jedoch gibt es einen gewaltigen Haken. Der »Konvent für Deutschland« stellt sich auf den Standpunkt, daß man in den Wahlkreisen zwar Stichwahlen durchführen könnte, dies aber auch nicht unbedingt sein müsse. Führt man keine Stichwahl zwischen den beiden bestplazierten Kandidaten durch, könnten einige der Abgeordneten teilweise bereits mit 32% oder gar auch nur 26% - was bei der letzten Bundestagswahl durchaus vorgekommen ist - in den Bundestag einziehen. Sie würden gerade mal ein Viertel der Wähler/innen des Wahlkreises repräsentieren, während die Wahlentscheidung der anderen drei Viertel unberücksichtigt bliebe, jedenfalls bei der Erststimme. Insofern wäre es jedenfalls zwingend notwendig, bei den Kandidaten, die nicht mindestens 50% der abgegebenen Stimmen erreichen, eine Stichwahl mit dem zweitplazierten Kandidaten durchzuführen, um wenigstens halbwegs Legitimation herzustellen.
Eine vollständige Legitimation würde des dennoch nicht bedeuten, weil erfahrungsgemäß bei einer Stichwahl weniger Wähler/innen teilnehmen als bei der Hauptwahl. Überdies ist die Auswahl der Kandidaten eingeschränkt, so daß viele Wähler/innen gar nicht mehr in der Lage sind, ihrer politischen Präferenz Ausdruck zu verleihen.
Eine weitere Folge dieses Wahlrechts wäre, daß das Mehrheitswahlrecht durch die Hintertür eingeführt würde. Zwar würden die kleinen Parteien noch über die Zweitstimmen in den Bundestag einziehen können, jedoch würden sie für die Regierungsbildung keine Rolle mehr spielen.
Wäre bereits bei der Bundestagswahl 2009 das »Grabenwahlsystem« im Sinne des »Konvents für Deutschland« ohne Stichwahl durchgeführt worden, käme es zur folgenden Sitzverteilung (Zeile »Graben«). In der Zeile BT 2009 wird die aktuelle Sitzverteilung gegenübergestellt, darunter die »Gewinne« und »Verluste«:
|
|
CDU/CSU |
SPD |
GRÜ |
FDP |
Linke. |
|
Graben |
327 |
136 |
35 |
46 |
54 |
|
BT 2009 |
239 |
146 |
68 |
93 |
76 |
|
Differenz |
+ 88 |
- 10 |
- 33 |
- 47 |
- 22 |
Anmerkung zur Tabelle: Spalte Graben: Eigene Berechnung anhand des Wahlergebnisses, Dokumentiert auf der Homepage des Bundeswahlleiters. Für die Berechnung der Zweitstimmen wurde das Verfahren nach Hare/Niemeyer benutzt. Quelle der Sitzverteilung BT 2009: Homepage des Bundeswahlleiters.
Auffällig ist, daß die CDU/CSU nach dem »Grabenwahlsystem« deutlich mehr Mandate bekommen hätte als nach dem gegenwärtigen Wahlrecht, dem personalisierten Verhältniswahlrecht. Die Anzahl der Mandate, die die CDU/CSU nach dem »Grabenwahlsystem« erhalten würde, entspricht 54.7% der Mandate im Bundestag. Dem steht gegenüber, daß die CDU/CSU bei der Bundestagswahl 39.4% der Erststimmen und 33.8% der Zweitstimmen erhalten hat. Daß sie trotzdem über die absolute Mehrheit der Mandate im Bundestag verfügte kommt daher, daß die Hälfte der Abgeordneten über das Mehrheitswahlrecht bestimmt worden wäre. Der »Konvent für Deutschland« lobt an diesem Wahlrecht, daß es zu »klaren Verhältnissen« führen würde. Das ist durchaus der Fall, aber um den Preis, daß der Wählerwille erheblich verzerrt wird und die kleinen Parteien nur noch Beiwerk sind.
Hinsichtlich des Problems des negativen Stimmgewichts und der Überhangmandate wird beklagt, daß diese zu einer Verzerrung des Wahlergebnisses führten. Tatsächlich aber verzerren Überhangmandate und negatives Stimmgewicht den Wählerwillen nicht so dramatisch wie das »Grabenwahlsystem«. Insofern wäre das »Grabenwahlsystem« als Lösung des Problems denkbar ungeeignet. Es wäre auch ein Bruch mit der Wahlrechtstradition in Deutschland, die wesentlich durch die Verhältniswahl geprägt ist. Daß das Mehrheitswahlrecht oder eine Variante von selbigem in Deutschland auf die Akzeptanz der Wähler/innen stoßen würde, ist mehr als fraglich.
Statt dessen sind die gegenwärtig diskutierten Lösungen besser geeignet, das Problem zu lösen. Auf der einen Seite steht der überparteiliche Kompromiß, in dessen Rahmen die Überhangmandate ausgeglichen werden. Auf der anderen Seite schlägt die Linkspartei vor, auf die Unterverteilung zu verzichten und die wenigen externen Überhangmandate, die entstehen können, auszugleichen. Beide Lösungen entsprechenden den Vorgaben des Verfassungsgerichts und würden zu einer Beseitigung des negativen Stimmgewichts führen.
© Udo Ehrich 29.12.2010, 23.02.2011 und 18.01.2013
Weiterführend: Lübbert, Daniel: Negative Stimmgewichte und die Reform des Bundestagswahlrechts. (2009) Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages,
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2009/negative_stimmgewichte.pdf (29.12.2010)
Wahlen? Die Wahlrechtsreformen von 2011 bis 2023
Die 7. erweiterte und überarbeitete Auflage des Buches »Wahlen?« ist in diesen Tagen als Taschenbuch erschienen und wird in den nächsten Wochen auch als E-Book erhältlich sein. Die neue Auflage ist um die Entwicklung der Wahlrechtsreform von 2023 aktualisiert worden und umfaßt jetzt das vollständige neue Wahlrecht. Das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag wurde vom Bundesverfassungsgericht 2008 wegen des sogenannten inversen Erfolgswertes als verfassungswidrig verworfen. Nach zwei Reformen des Wahlrechts und eingehender politischer Debatten setzte die »Ampel-Koalition« im Jahr 2023 eine umstrittene Reform durch, die auch die verbleibenden Probleme im Wahlrecht lösen sollte. Mit der Beseitigung des negativen Erfolgswertes erschien der Hauptauftrag des Bundesverfassungsgerichts zwar erfüllt, gleichzeitig aber zeigte sich, daß das zweite von den Verfassungsrichtern bezeichnete Problem, nämlich die Überhangmandate, weiteren Reformbedarf erzeugten. Dieses Buch stellt die Wahlrechts-Reformen seit 2011 umfassend dar und zeigt darüber hinaus weitere Reformvorschläge auf. Zudem werden aktuelle Themen behandelt wie die Wiederholung der Wahlen von 2021 in Berlin und die Debatte und die Urteile um das Paritätswahlrecht. Die 7. Auflage wurde um die komplette Wahlrechtsreform der »Ampel-Koalition« und auch hinsichtlich weiterer Aspekte der Entwicklung des Wahlrechts erweitert. Änderungen und deren Wirkungen auf das Bundestagswahlrecht werden gezeigt und diskutiert und in umfangreichen Berechnungsbeispielen anschaulich gemacht. Des weiteren wurde die neue Auflage um die aktuellen Entwicklungen bei der Wiederholungswahl in Berlin sowie den neueren Verfassungsgerichtsurteilen zur Einführung eines Paritätswahlrechts erweitert. Dargestellt und diskutiert werden auch die Berichte der Wahlrechtskommission, die von der »Ampel-Koalition« beauftragt wurde, Vorschläge zur Reform des Wahlrechts zu machen. Dieses Buch stellt den Prozeß der Reformen beim Bundestags- und Europawahlrecht dar, zeigt neben den Vorschlägen der Parteien auch weitere Alternativen auf und betrachtet die Ergebnisse dieser Reformen. Es leistet damit einen Beitrag zur Wahlrechtsdebatte und will durch seine verständliche Darstellung zugleich Interesse an diesem Thema wecken. Wahlen? Die Wahlrechtsreformen von 2011 bis 2023, erschienen bei BoD als Taschenbuch und als E-Book. Die Taschenbuch-Ausgabe hat 340 Seiten und ist für € 14.99 erhältlich. Das E-Buch wird bei Erscheinen einen Monat lang für einen Einführungspreis von € 3.99, dann (ab 5. Dezember 2023) für € 5.99 erhältlich sein. Taschenbuch bei BoD * E-Buch bei BoD Taschenbuch bei jpc * (jpc bietet leider keine E-Bücher an) Taschenbuch bei Eulenspiegel * E-Buch bei Eulenspiegel Taschenbuch bei buecher.de * E-Buch bei buecher.de Taschenbuch bei ebook.de * E-Buch bei ebook.de Amazon: Bei Amazon wird gegenwärtig die 6. Auflage als 7. Auflage angeboten. Sie hat nur 280 Seiten und ist inhaltlich durch die 7. Auflage überholt. Von einer Bestellung bei Amazon ist somit abzuraten, weil dort noch Exemplare der 6. Auflage auf Lager liegen, die dann möglicherweise verschickt werden. Thalia: Nachdem Thalia nicht in der Lage war, die Vorauflage von »INSM & Co.« aus dem Programm zu nehmen sondern auch Monate nach der Veröffentlichung der neuen Auflage die Vorauflage weiterhin im Shop anbot (die zugleich aber nicht bestellbar war), kam es zu einem Mailwechel bezüglich dieses Umstandes. Der Hinweis, daß alle anderen Buchshops in der Lage waren, die korrekte Auflage anzuzeigen, führte bei Thalia zu der Entscheidung, alle gedruckten Bücher des Autors aus dem Programm zu nehmen und nur noch die E-Bücher anzubieten. Dies bezieht sich auch auf neue Auflagen der Bücher dieses Autors. Somit kann auch hier kein Link und keine Empfehlung zum Kauf bei diesem Anbieter gegeben werden.